Rezension und Berichterstattung zu Rossinis „Il barbiere di Seviglia“ in Wiesbaden am ersten März 2013 im Rahmen der ersten Theaterfahrt 2013 der Ernst-Barlach-Realschule plus, Höhr-Grenzhausen
„Rossini, divino Maestro, Helios von Italien, der du deine klingenden Strahlen über die Welt verbreitest! Verzeih meinen armen Landsleuten … die deine Tiefe nicht sehen, weil du sie mit Rosen bedeckst, und denen du nicht gedankenschwer und gründlich genug bist, weil du so leicht flatterst, so gottbeflügelt!“ - Dieser, so schwärmerisch-schwülstigen Adresse an Gioachino Rossini (1792-1868), die so gar nicht zum sonstigen Duktus eines Heinrich Heine (1797-1856) passen will, kann man sich anschließen oder auch nicht, allerdings kommt man auch kaum um sie herum. Denn Rossinis Musik fasziniert und reißt auch heute, nach fast zweihundert Jahren, immer noch mit. Locker flockig kommt sie daher – oder sollte sie daherkommen –, ja, perlen und prickeln wie Champagner im Glas! Für Sänger und Musiker ist die Musik des Italieners deswegen oft kompliziert und schwer einzustudieren. Unglaublich anspruchsvoll ist für die Sänger die Silbenarbeit aufgrund der teilweise sehr hohen Geschwindigkeiten, und dann soll man dabei auch noch spielen und komisch wirken.
„Il barbiere di Siviglia“, zu deutsch „Der Barbier von Sevilla“, uraufgeführt 1816, war der Durchbruch des Vierundzwanzigjährigen, jene Oper, die ihn berühmt machen sollte. Die Handlung ist dabei recht flach und banal, sie entbehrt jeglichen Tiefgangs und eine ernsthafte Auseinandersetzung scheint unnötig, da ihr einziger Zweck in einer guten Unterhaltung des Publikums zu liegen scheint: Bartholo, Arzt und Vormund der jungen Rosina, verliebt sich in sein Mündel und möchte sie heiraten. Rosina hingegen bekommt vom jungen Grafen Almaviva den Hof gemacht, beide gestehen sich ihre Liebe. Bartholo versucht, das zu verhindern, indem er Rosina am nächsten Tag heiraten will. Figaro, der Barbier von Sevilla, der sich schon oft als Kuppler verdient gemacht hat und die Geheimnisse vieler Frauen und Familien in Sevilla kennt, kommt dem Grafen zu Hilfe und mit vereinten Kräften gelingt nach etlichen Verwicklungen und amourösen Abenteuern ein Happy End: Der Graf bekommt seine Rosina, Bartholo geht leer aus.
Nicht so jedoch die Vorlage: Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), den man den „Sturmvogel der Revolution“ nannte, schrieb keine harmlosen, rein unterhaltenden seichten Texte: „Laster, Missbrauch und Willkür ändern sich nicht, sondern verstecken sich unter tausend Formen hinter der Maske der herrschenden Sitten: die Maske herunterzureißen ist die edle Aufgabe dessen, der sich dem Theater verschreibt. Ob er er nun lachend oder weinend moralisiert … Man kann die Menschen nur verändern, indem man sie zeigt, wie sie sind. Die wirksame, wahrhaftige Komödie ist keine Lobeshymne, kein hohler akademischer Diskurs.“ So schreibt Beaumarchais in seinem Vorwort zu seiner als „Roman der Familie Almaviva“erdachten Trilogie, die aus den drei Stücken „Der Barbier von Sevilla oder Die nutzlose Vorsicht“ (1775), „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ (1784) und „Ein zweiter Tartuffe oder Die Schuld der Mutter“ (1792) besteht. Man sieht, Rossini vertont den ersten Teil dieser Trilogie, das Libretto schreibt ihm Cesare Sterbini (1784-1831), während sich Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791) bereits 1786 mit „Le nozze di Figaro“ nach einem Libretto von Lorenzo da Ponte (1749-1838) sehr erfolgreich des zweiten Teils angenommen hatte. Doch Rossini's Werk ist bereits die zweite musikdramatische Umsetzung des ersten Teils, die erste stammt von Giovanni Paisiello (1740-1816) und wurde bereits 1782 in St. Petersburg uraufgeführt.
Das ausgehende 18. und beginnende 19. Jahrhundert ist eine umtriebe, gefährliche Zeit in Europa. Die zunehmenden Spannungen aufgrund der sozialen Ungerechtigkeiten drohen die Ständeordnung zu sprengen, was in einem ersten Höhepunkt, der Französischen Revolution von 1789, gipfelt, weiter zum Aufstieg und Fall des großen Korsen Napoleon I. Bonaparte, der sich 1804 selbst zum Kaiser aller Franzosen krönt, bis hin zur vorläufigen politischen Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress 1814/15 führt. Und in dieser Zeit erzählt Beaumarchais von Dienern und Untergebenen, die sich gegen ihre Herrschaft auflehnen, die sich ungebührlich benehmen, sich aufmüpfig zeigen und – durchaus nicht nur verbal – die Grenze ihres jeweiligen Standes durchbrechen. Paisiello, Mozart und Rossini tragen dieses revolutionäre Gedankengut auch noch auf die Opernbühne! Man kann sich vorstellen, warum diese Stücke den Adel beunruhigten und sogar dazu veranlassten, sie zu verbieten. Aber heute?
Wie steht es heute mit dem Verständnis von derartigem Gedankengut? Wo lehnen wir uns heute noch gegen bestehende Konventionen und politisches Kalkül auf? Ist uns unsere Bequemlichkeit heutzutage lieber als auf die Barrikaden zu gehen?
Das Staatstheater Wiesbaden hat den „Barbier“ jetzt nun schon etwas über zwei Jahre im Programm. Was meine Schülerinnen und Schüler, einige Ehemalige, Eltern und Kollegen am gestrigen Freitagnachmittag und -abend auf unserer ersten Theaterfahrt im Jahr 2013 erleben durften, war also keine neue Inszenierung, es war solide einstudierte Qualitätsarbeit, die dennoch eine Menge zu wünschen übrig ließ. Und das trotz einer Anspielung auf den aktuellen Pferdefleischskandal.
Wir waren etwas früher angereist, da man uns seitens der Operndirektion freundlicherweise eine Führung versprochen hatte, die von Karin Dietrich, der für den „Barbier“ zuständigen Dramaturgin selbst und einem weiteren Mitarbeiter des Theaters durchgeführt wurde. Unsere achtzig Teilnehmer wurden also in zwei Gruppen aufgeteilt und erlebten eine hochinteressante und sehr informative Führung in die Katakomben der Theater-„Stadt“, die uns ihre Tore öffnete, nachdem wir den Zuschauerraum, in dem uns eine kurze Einführung in die Bühne gegeben wurde, verlassen hatten. Unzählige Räume und Werkstätten, die Schreinerei, in der die Holzteile für die Bühne hergestellt werden, die Schlosserei und die riesige Malerhalle, in der mit Pinseln so groß wie Besen riesige Bilder auf dem Boden liegend gemalt wurden, aber auch Bühnentechnik und vieles mehr konnten wir erkunden und wurde uns erklärt. An dieser Stelle noch einmal ein großes Lob und ein dickes Dankeschön an Karin Dietrich und die Operndirektion, dass uns dieser erregende Einblick in den Backstagebereich ermöglich wurde. Die Führung endete dann im „Studio“, einer kleinen Probebühne, auf der man uns den Inhalt der vor uns liegenden Oper ausführlich erläuterte und auch Raum für Fragen bot; eine Maßnahme, die ich angesichts einer Oper in italienischer Sprache durchaus für wichtig und angebracht halte, wenn man sie mit Schülerinnen und Schülern besucht.
Zur Inszenierung nur einige wenige Worte, die durchaus kritisch sind, vor dem Hintergrund, dass Wiesbaden den Anspruch erhebt, sich mit großen Häusern wie Frankfurt, München und Berlin vergleichen zu wollen. Das Bühnenbild war aufgrund von nur zwei Schauplätzen, die durch eine Drehvorrichtung relativ schnell, verändert werden konnte, ein wenig eintönig zwar, aber in seiner Simplizität durchaus gelungen. Die Kostüme, ganz nach dem Motiv des Kaktus und des Stacheligen im Allgemeinen gestaltet, bestachen durch poppigen Schnitt und sehr phantasievolle Farben. Weniger erbaulich waren die Sänger des Abends. Gesanglich waren mit Ausnahme Don Basilios, eines sehr schönen profunden Basses mit herrlicher Technik, für den der Basilio eine wirklich undankbare Rolle abgab, keine großen Glanzlichter dabei. Das Orchester intonierte stellenweise sehr unsauber, die Einsätze kamen wenig präzise. Außerdem waren wahlweise die Sänger zu leise und kamen nicht gegen das Orchester an oder das Orchester war zu laut und übertönte die Sänger, die an vielen Stellen überhaupt nicht zu verstehen waren, ja an einigen Stellen konnte man sie gar nicht hören – gleichwohl, klanglich konnte das Ensemble an diesem Abend wenig überzeugen. Leider! Nur in den Rezitativen, die einzig und allein vom Cembalo begleitet wurden, gelang ein schöner, anheimelnder Klang. Diese Defizite wurden teilweise von den herrlich komischen Slapstick-Einlagen des frisch aufspielenden Ensembles herausgerissen, die durch die grundsätzliche Ausrichtung auf die Charakterfiguren der Commedia dell'arte, auf die Beaumarchais seine Figurenkonstellationen ausrichtet, erst ermöglicht wurden.
Ein musikdramatisches Werk ist ja immer an die Gegebenheiten und Gepflogenheiten des Librettos und der Partitur gebunden, trotzdem hätten dem Stück einige konzentrierende Striche gutgetan. Es gab, vor allem in der Mitte des ersten Teils und zu Beginn des zweiten Teils einige unschöne Längen und man fühlte sich ein wenig an die Reaktionen des Publikums bei der Uraufführung in Rom erinnert: „Die Römer fanden den Anfang der Oper langweilig und sehr viel schlechter als den von Paisiello. Sie suchten vergeblich nach dessen unnachahmlich naiver Anmut und jenem Stil, der ein Wunder an Schlichtheit ist. (…) 1816 verstanden die Römer noch nichts von Mozart. (…) Schließlich verlangten die Zuschauer, gelangweilt von der gewöhnlichen Musik zu Beginn des zweiten Akts und entrüstet über den völligen Mangel an Ausdruckskraft: „Vorhang zu!“ - was dann auch geschah!“(aus dem Programmheft zur Oper, S.37)
Als dann alle um 22:30 Uhr wieder im Bus saßen, waren die Reaktionen dann doch sehr gemischt. Die Spannweite der Meinungen reichte von: „Das war das Langweiligste, was ich je erlebt habe!“ bis hin zu „Das hat mir wahnsinnig gut gefallen! Das war so witzig! Habe nur gelacht!“. Sogar über die Tatsache, dass die Oper in der Originalsprache gegeben worden war, gab es Äußerungen wie: „Ich hätte die deutschen Obertitel manchmal überhaupt nicht gebraucht. Die haben das so gut rübergebracht, das war gut auch so zu verstehen.“ Und da soll noch mal einer sagen, unsere Jugendlichen seien nicht zu einer echten Kritik fähig.
Was bleibt unter'm Strich übrig? Eine durchaus gelungene Theaterfahrt war das, ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten, eine Erfahrungen, wie sie für junge Menschen prägend sein kann, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und beenden möchte ich in diesen doch sehr zitatlastigen Text mit einem allerletzten Zitat aus dem Film „Pretty Woman“. Dort haucht Richard Gere (*1949) Julia Roberts (*1967) sanft ins Ohr: „Leute, die zum ersten Mal in der Oper sind, reagieren oft sehr überraschend. Entweder mögen sie die Oper, oder sie hassen sie. Wenn sie die Oper lieben, dann ist es für immer. Die andern – tun mir Leid. Denn die Musik wird nie ein Teil ihrer Seele werden.“


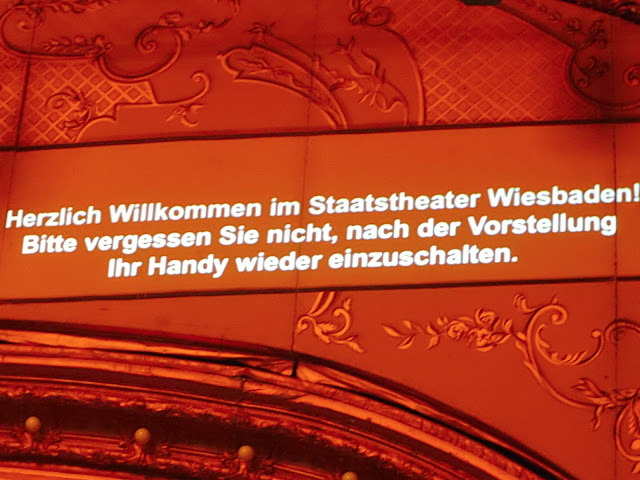









































Kommentare
Kommentar veröffentlichen